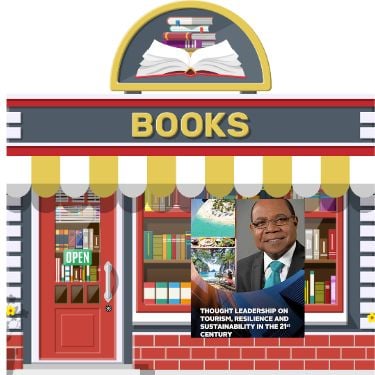Port Au Prince, Haiti – Entführungen, Bandengewalt, Drogenhandel, korrupte Polizei, brennende Straßenblockaden.
Die Berichte aus dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre reichen aus, um den abenteuerlustigsten Reisenden fernzuhalten.
Doch nach Angaben von Sicherheitsexperten und Beamten der Friedensmission der Vereinten Nationen in Port-au-Prince ist Haiti nicht gewalttätiger als jedes andere Land Lateinamerikas.
„Das ist ein großer Mythos“, sagt Fred Blaise, Sprecher der UN-Polizei in Haiti. „Port-au-Prince ist nicht gefährlicher als jede Großstadt. Sie können nach New York gehen und dort gestohlen und mit vorgehaltener Waffe festgehalten werden. Gleiches gilt für Städte in Mexiko oder Brasilien.“
Haitis negatives Image hat seine Wirtschaft verwüstet, deren einst boomende Tourismusindustrie heute weitgehend auf Helfer, Friedenstruppen und Diplomaten beschränkt ist.
UN-Daten deuten jedoch darauf hin, dass das Land zu den sichersten in der Region gehören könnte.
Nach Angaben der UN-Friedensmission gab es in Haiti im vergangenen Jahr 487 Morde oder etwa 5.6 pro 100,000 Einwohner. Eine gemeinsame Studie der UNO und der Weltbank aus dem Jahr 2007 schätzte die durchschnittliche Mordrate in der Karibik auf 30 pro 100,000, wobei Jamaika fast neunmal so viele Morde verzeichnete – 49 Morde pro 100,000 Menschen – als die UN in Haiti.
Im Jahr 2006 verzeichnete die Dominikanische Republik mehr als viermal so viele Tötungsdelikte pro Kopf wie Haiti – 23.6 pro 100,000, so das Central American Observatory on Violence.
„Es gibt nicht viel Gewalt [in Haiti]“, argumentiert General Jose Elito Carvalho Siquiera, der ehemalige brasilianische Kommandeur der UN-Truppen in Haiti. „Wenn man die Armut hier mit der von São Paolo oder anderen Städten vergleicht, gibt es dort mehr Gewalt.“
Die UN-Friedensmission, bekannt als Minustah, traf im Juni 2004 ein, drei Monate nachdem US-Truppen den ehemaligen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide inmitten einer bewaffneten Rebellion ins afrikanische Exil getrieben hatten.
Die De-facto-Interimsregierung, unterstützt von den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Kanada, startete eine repressive Kampagne gegen Aristides Unterstützer und entfachte zwei Jahre lang Schießereien in den Slums von Port-au-Prince zwischen Gangs, der haitianischen Polizei und UN-Friedenstruppen.
Unterdessen führte eine Entführungswelle zu Spannungen, wobei Minustah in den Jahren 1,356 und 2005 2006 registrierte.
„Die Entführungen haben alle schockiert, weil sie in der Vergangenheit nicht passiert waren“, sagt Mr. Blaise. „Dennoch, wenn man die Zahl der Entführungen hier vergleicht, glaube ich nicht, dass es mehr ist als anderswo.“
Im vergangenen Jahr hat sich die Sicherheit deutlich verbessert, da die Zahl der Entführungen um fast 70 Prozent zurückgegangen ist. Dies ist Teil einer allgemeinen Verbesserung der Sicherheit unter Präsident René Préval, der im Februar 2006 erdrutschartig gewählt wurde. Aber Anfang dieses Monats gingen Tausende von Demonstranten in Port-au-Prince, um gegen eine Zunahme von Entführungen zu protestieren. Nach Angaben der haitianischen und der UN-Polizei wurden in diesem Jahr mindestens 160 Menschen entführt, berichtet Reuters. Im gesamten Jahr 2007 wurden 237 Menschen entführt, heißt es in dem Bericht.
Und im April gingen Tausende von Menschen auf die Straße, um niedrigere Lebensmittelpreise zu fordern, und schickten Bilder von brennenden Reifen und Steine werfenden Demonstranten in die ganze Welt.
Dennoch hört man in Port-au-Prince nur noch selten Schüsse, und Übergriffe auf Ausländer gibt es nur wenige. In den letzten Monaten waren die Flüge von American Airlines ab Miami mit christlichen Missionaren überfüllt.
Einige Beobachter sagen, selbst wenn die Instabilität am schlimmsten war, beschränkte sich die Gewalt normalerweise auf einige Slums von Port-au-Prince.
„Wenn man Haiti mit dem Irak, mit Afghanistan, mit Ruanda vergleicht, erscheinen wir nicht einmal in dieser Größenordnung“, sagt Patrick Elie, ein ehemaliger Verteidigungsminister, der eine Regierungskommission zur möglichen Schaffung einer neuen Sicherheitstruppe leitet.
„Wir haben eine turbulente Geschichte hinter uns, die von politischer Instabilität geprägt ist“, sagt Elie. „Aber außer dem Krieg, den wir führen mussten, um unsere Freiheit und Unabhängigkeit von den Franzosen zu erlangen, hat Haiti nie ein Ausmaß an Gewalt erlebt, das mit dem in Europa, Amerika und den europäischen Ländern Afrikas und Asiens vergleichbar ist.“ .“
Viva Rio, eine in Brasilien ansässige Gruppe zur Bekämpfung von Gewalt, die auf Ersuchen der UNO nach Haiti kam, schaffte es im März 2007, kriegerische Banden in Bel Air und benachbarten Slums in der Innenstadt davon zu überzeugen, im Austausch für Jugendstipendien auf Gewalt zu verzichten. „Das wäre in Rio undenkbar“, sagt Rubem Cesar Fernandes, Direktor von Viva Rio.
Anders als in Brasilien, sagt er, seien Haitis Slum-Gangs wenig in den Drogenhandel involviert. „In Haiti gibt es derzeit mehr Interesse an Frieden als an Krieg“, sagt er. „[D]hier ist dieses Vorurteil, das Haiti mit Gefahr in Verbindung bringt, vor allem in den Vereinigten Staaten. Haiti scheint bei den weißen Nordamerikanern Angst zu provozieren.“
Katherine Smith ist eine Amerikanerin, die keine Angst hat. Die junge Ethnographin kommt seit 1999 hierher, um Voodoo zu erforschen und fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Armenviertel.
„Das Schlimmste, was passiert ist, waren Taschendiebstahl während des Karnevals, aber das könnte überall passieren“, sagte Frau Smith. „Wie wenig ich angegriffen wurde, ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie sichtbar ich bin.“
Aber viele Helfer, Diplomaten und andere Ausländer leben hinter Mauern und Ziehharmonika.
Und abgesehen von Emigranten aus dem Ausland ist Tourismus so gut wie nicht existent. „Es ist so frustrierend“, sagt Jacqui Labrom, eine ehemalige Missionarin, die seit 1997 Führungen durch Haiti organisiert.
Sie sagt, dass Straßendemonstrationen leicht vermieden werden und selten zu Gewalt führen. „In den 50er und 60er Jahren lehrte Haiti Kuba, Jamaika und die Dominikanische Republik, wie man Tourismus macht…. Wenn wir nicht so eine schlechte Presse hätten, würde das einen großen Unterschied machen.“
csmonitor.com